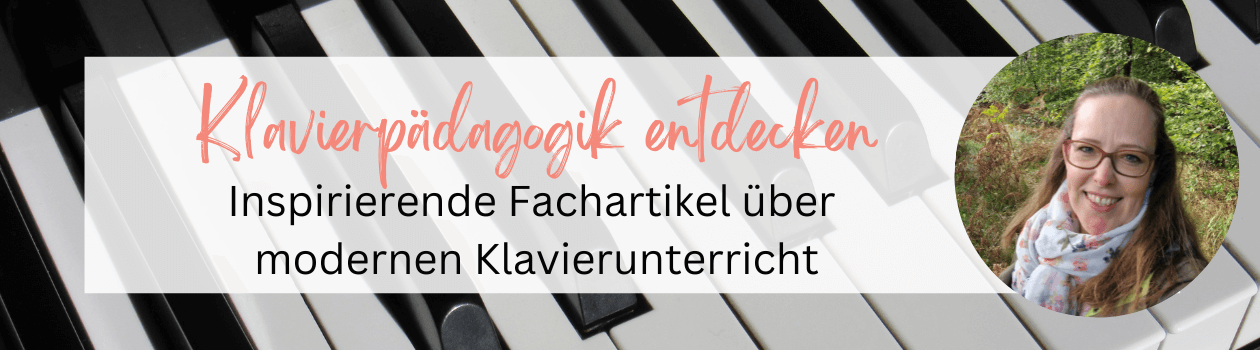Wer kennt sie nicht? Unkonzentrierte und unruhige Schüler*innen im Vor- und Grundschulalter. Die Füße baumeln, die Hände sind irgendwo 8 aber nicht auf den Tasten) und irgendwas wird geplappert oder gefragt. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Fehlanzeige! Da hat man selbst schon Probleme sich zu konzentrieren…
Es gibt viele Gründe, warum Schüler*innen unruhig und hibbelig sind. Vielleicht sind sie noch sehr jung, müde, hatten zu wenig Bewegung, haben ADHS oder dürfen zu Hause vielleicht immer laut sein und wild toben.
Fragst du dich, wie du diese unkonzentrierten Kinder unterrichten kannst?
In diesem Artikel stelle ich dir fünf Strategien vor, mit denen du sofort mehr Ruhe in deine Unterrichtsstunden bekommen kannst.